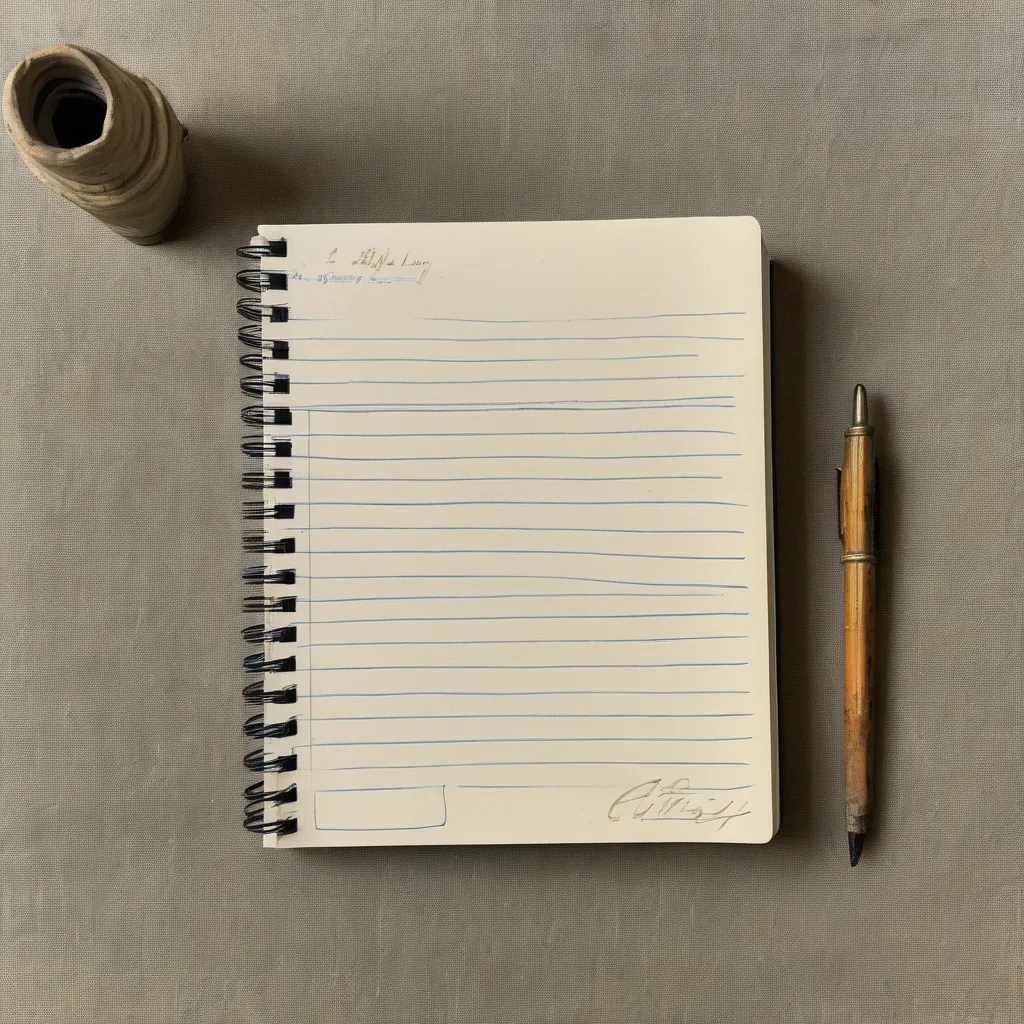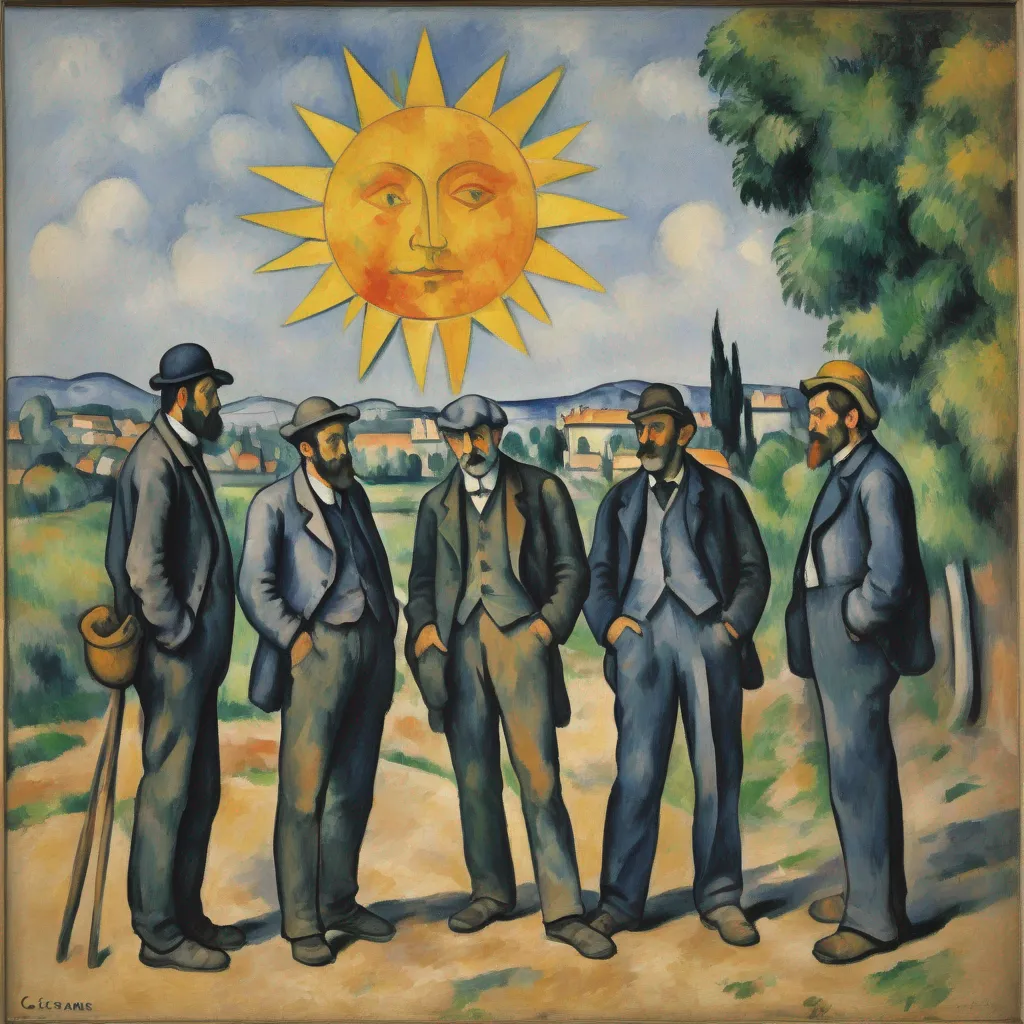Mangel an Kassensitzen
Der wichtigste Grund für den Patient:innen, die eine Psychotherapie suchen, liegt in einer Besonderheit des deutschen Gesundheitssystems. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) reguliert über das Instrument der Kassensitze die Zahl an Psychotherapeut:inne, die ihre Leistungen den gesetzlich Versicherten zur Verfügung stellen dürfen. Auf Landesebene wird durch die jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigungen gemeinsam mit den Landesverbänden der Krankenkassen und der Ersatzkassen ein regionaler Bedarfsplan erstellt. Dieser Plan beschreibt und analysiert die aktuelle Versorgungssituation und dokumentiert die Umsetzung der bundesweiten Vorgaben. Die zuständigen Landesbehörden und Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen von Patient:innen und behinderter Menschen haben dabei lediglich die Gelegenheit zur Stellungnahme.
Die bisher höchstens in Fachkreisen geführte Debatte um das Vergabeverfahren der Kassensitze hat, während der Covid-19-Pandemie, erstmals gesteigerte mediale Aufmerksamkeit erhalten und wirft Licht auf ein seit Jahrzehnten praktiziertes Verfahren. Vielen Patient:innen und und Psychotherapeut:innen erscheint das nicht mehr zeitgemäß. Verschiedene Petitionen und ein öffentlicher Diskurs sind die unmittelbare Folge.
Obwohl für Psychotherapeut:innen grundsätzliche Niederlassungsfreiheit herrscht, bleibt das Anrecht für jede Praxis auf einen Kassensitz oder zumindest eine massive Erhöhung der Zahl der Kassensitze zumindest mittelfristig unwahrscheinlich. Die Gründe dafür sind vielfältig und über Jahrzehnte gewachsen. Die teilweise gegensätzlichen Interessenlagen der an einem möglichen Änderungsprozess beteiligten Akteure und die traditionell langsame Geschwindigkeit in der Reformation des Gesundheitswesens lassen wenig Hoffnung für kurzfristige Erfolge der Befürworter eines Kurswechsels aufkommen.
Gesetzliche Krankenversicherungen in der Verantwortung
Trotz des Status Quo stehen die Krankenkassen nach wie vor gegenüber ihren Versicherten in der Verantwortung, wenn diese eine Behandlung benötigen. Als Körperschaften des öffentlichen Rechts nehmen gesetzliche Krankenkassen öffentliche Aufgaben wahr und tragen eine besondere gesellschaftliche Verantwortung. Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang sind Patient:innen-Rechte. Das Sozialgesetzbuch V liefert dafür die rechtliche Grundlage (§ 13 Abs. 3 SGB V): „Konnte die Krankenkasse eine unaufschiebbare Leistung nicht rechtzeitig erbringen oder hat sie eine Leistung zu Unrecht abgelehnt und sind dadurch Versicherten für die selbstbeschaffte Leistung Kosten entstanden, sind diese von der Krankenkasse in der entstandenen Höhe zu erstatten, soweit die Leistung notwendig war.“
Das Recht auf fachlich und zeitlich angemessene Behandlung gilt für alle medizinischen Fachrichtungen. Die Handhabung und Durchsetzung ist Auslegungssache, fallspezifisch und hängt von der beteiligten Krankenkasse ab. Eine standardisierte Handhabung hat sich bisher nicht etabliert. Trotzdem ist die grundsätzliche Möglichkeit, sich im Falle eines Systemversagens Leistungen selbst zu beschaffen und erstatten zu lassen, für Patient:innen und deren Psychotherapeut:innen eine wirkmächtige Option. Was sind also die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit Patient:innen von ihrem Recht Gebrauch machen können? Was ist eine “notwendige Leistung”? Was bedeutet “nicht rechtzeitig” in der Psychotherapie? Und gibt es Wege, Patient:innen in der Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen?
Erforderliche Dokumente
Die konkreten Anforderungen an die Umsetzung sind nur bei wenigen Krankenkassen prominent online einsehbar und müssen im Gespräch in Hotlines erfragt werden. In jedem Fall erwartet Patient:innen ein bürokratieintensiver Prozess, der präzise Dokumentation und ein hohes Maß an Geduld erfordert.
Probatorik und Psychotherapie werden getrennt voneinander betrachtet und beantragt. Für die Probatorik werden i.d.R. benötigt
- Persönliches Anschreiben der Patient:in
- Nachweis über den Besuch einer Sprechstunde (PTV 11)
- Dringlichkeitsbescheinigung einer Fachärzt:in (Dringlichkeitscode)
- Bescheinigung durch eine Terminservicestelle (TSS) über erfolglosen Vermittlungsversuch
- Telefon- und E-Mail-Protokoll mit Ablehnungen durch Vertragstherapeut:innen
- Anschreiben der Therapeut:in
- Qualifikationsnachweis der Ärzt:in (Approbationsurkunde)
- Lebenslange Arztnummer (LANR)
- Kostenvoranschlag
- Konsiliarbericht durch Allgmeinmediziner:in
Um die eigentliche Psychotherapie durch nicht-Vertragstherapeut:innen erfolgreich bewilligt zu bekommen, ist in der Regel erforderlich
- Bescheinigung über absolvierte Probatorik (min. 2 Sitzungen)
- Medizinisches Gutachten/ Fallbeschreibung durch die Psychotherapeu:in
- Therapieplan
Einheitliche Angaben zu den erforderlichen Ablehnungen am Telefon oder den Inhalten der erforderlichen Anschreiben sind bei den wenigsten Krankenkassen verfügbar. Krankenkassen betonen, dass es sich stets um einen Einzelfall handelt und individuell entschieden wird.
Weil die Krankenkassen die gleichen Anforderungen an private Behandelnde stellen wie an ihre zugelassenen Vertragstherapeut:innen, scheinen die administrativen Hürden auf den ersten Blick nicht nur erforderlich, sondern auch angemessen. Gemessen an den Möglichkeiten zur Automatisierung eines solchen Antrags und dem Fortschritt der Krankenkassen in anderen digitalen Feldern begegnen Patient:innen einem vergleichsweise schwierigen Verwaltungsakt. Vor dem Hintergrund der schwierigen Lage, in der sich Versicherte häufig auf der Suche nach der richtigen Behandlung befinden, stellen die Anforderungen der Krankenkassen an die Eigenverantwortlichkeit nicht selten eine unüberwindbare Hürde dar.
Unbekannte Ablehnungsquote
Die Deutsche Psychotherapeuten Vereinigung (DPtV) sieht einen “restriktiven Kurs” bei der Handhabung der Kostenerstattungsverfahren. Einer Umfrage (2021) zufolge werden 48% der Anträge abgelehnt. Die mittlere Ablehnungsrate ist demzufolge sowohl beim Erstantrag als auch nach einem ersten Widerspruch gestiegen. Einer Versorgungsstudie von zehn Landespsychotherapeutenkammern (2018) zufolge ist die Begründung durch Krankenkassen in zahlreichen Fällen nicht stichhaltig. 56% der Befragten berichten, Krankenkassen würden Patient:innen mitteilen, dass Kostenerstattung nicht mehr erlaubt sei. 82% der Befragten gaben an, dass es zu Ablehnungen komme, die mit der Einführung der Vermittlung der Terminservicestellen (2017) in Sprechstunde und Akutbehandlung begründet wurden.
Wenig Bewusstsein für Patient:innenrechte
Obwohl die Gesetzeslage eindeutig ist, sind sich die wenigsten der gesetzlich Versicherten über die grundsätzliche Möglichkeit der Kostenerstattung bewusst. Das ist erstaunlich, weil das Wissen über Patient:innen in ähnlich elementaren Bereichen stark ausgeprägt ist. Die große Mehrheit der Patient:innen weiß schließlich, dass sie sich ihre Psychotherapeut:in oder Ärzt:in frei aussuchen darf (Freie Arztwahl, § 76 Abs. 1 SGB V).
Die schwierige Durchsetzung des eigenen Rechts bei Krankenkassen lässt in vielen Fällen nur den Rechtsweg offen. Für viele Betroffene bleibt das lange Warten oder Selbstzahlung im Vergleich zu den Unwägbarkeiten einer Klage die verträglichere Option.
Seit August 2013 ist es nicht mehr möglich, die Kosten für psychotherapeutische Behandlungen im Rahmen der Kostenerstattung zu beziffern, bzw. werden diese Daten von den Krankenkassen nicht mehr veröffentlicht. Im Jahr 2012 betrug der Anteil der Kostenerstattungen am Gesamtleistungsvolumen für ambulante psychotherapeutische Leistungen 3%. Eine belastbare Prognose zur weiteren Entwicklung des Kostenerstattungsverfahrens gestaltet sich aufgrund der unvollständigen Datenlage schwierig.
Einfache Hilfe
Patient:innen haben die Möglichkeit, den organisatorischen Aufwand für die Durchsetzung ihrer Rechte per Vollmacht an eine kompetente Stelle zu übertragen. So lassen sich bis auf das Erstgespräch mit einer Psychotherapeut:in vor Ort sowie der Konsiliarbericht „outsourcen“. Im Vergleich zu einer normalen Psychotherapie bei einer Vertragstherapeut:in entsteht somit kein Zusatzaufwand.
Das „Outsourcing“ hat zusätzlich den Vorteil, dass durch jahrelange Erfahrung eine deutlich höhere Erfolgsquote möglich ist als bei einzelnen Psychotherapeut:innen, die nur gelegentlich Kostenerstattungsverfahren begleiten.